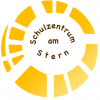Chemie ganz praktisch: Seidenraupen und die Welt der Proteine
Seidenraupen in Potsdam? Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat hier eine lange Tradition. Schon unter Friedrich dem Großen wurden in der Region Maulbeerbäume gepflanzt, um die Zucht von Seidenraupen zu ermöglichen. Auch auf unserem Schulgelände lebt diese Tradition fort: Die Landschaftsarchitektin achtete bei der Neugestaltung des Schulhofes darauf, Maulbeerbäume an der Westseite des Hofs zu pflanzen – wohl wissend um die Geschichte. Tatsächlich wurden auch in der DDR in vielen Schulen Seidenraupen gehalten und es gab sogar eine Handreichung, die „Seidenbaufibel der Jungen Pioniere„, sodass sich die Zucht als Tradition über mehrere Jahrhunderte zieht.
Nun sind die Tiere für die kurze Zeit ihres Lebens (ungefähr ein Monat liegt zwischen dem Schlüpfen und dem Spinnen des Kokons) auch Teil unseres Schullebens. Wenn die zunächst winzigen und am Ende fast fingergroßen Raupen im Raum stehen, heißt es bei den Jüngeren in der AG oder im Lernbüro meist spontan: „Wie süß!“ Ganz anders die Reaktionen in der Oberstufe: Hier ist die erste Begegnung oft begleitet von „Ihh!“ oder „Die sehen ja eklig aus!“. Doch schon bald weicht der Ekel einer Mischung aus Neugier und Staunen – schließlich kann man den Tieren beim Wachsen beinahe zusehen.
Im Chemieunterricht der Jahrgangsstufe 12 sind die Raupen Ausgangspunkt für eine besonders anschauliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Natürliche und synthetische makromolekulare Stoffe – Proteine und Kunststoffe“. Während die Schülerinnen und Schüler mit Strukturformeln und Reaktionsgleichungen arbeiten, zeigen die Raupen im Pappkarton, was das in der Natur bedeutet:
Aminosäuren werden im Unterricht als kleinste Bausteine besprochen, die über Peptidbindungen zu langen Proteinketten verknüpft sind. Daraus entstehen komplexe Strukturen, die in der Biologie spezifische Funktionen haben – im Fall der Seidenraupe etwa das Protein Fibroin, das den Faden des Kokons bildet.
Die Diskussion erweitert sich auf Kunstfasern wie Viskose, Polyester oder Nylon, die industriell hergestellt werden. Sie imitieren die Eigenschaften von Seide, sind aber ein Industrieprodukt – damit ist die Verbindung zwischen Naturstoff und technischem Ersatzstoff hergestellt.
Währenddessen fressen die Raupen unermüdlich Maulbeerblätter, häuten sich mehrfach und werden von Tag zu Tag größer. Inzwischen spinnen sie sich in ihre weißen Kokons ein – ein Prozess, der den Chemieunterricht buchstäblich sichtbar macht.
Neben den chemischen und biologischen Inhalten ist auch Raum für ethische Fragen notwendig: Ist es vertretbar, Seide zu gewinnen, wenn dafür die Raupen sterben? Für die Gewinnung von Seide wird der Kokon normalerweise aufgekocht, wodurch die Raupen sterben. Aber auch die Falter sind durch die jahrtausendelange Züchtung kaum lebensfähig, können nicht fliegen und sterben nach der Paarung bzw. dem Legen der Eier. Welche Alternativen gibt es? Und welche Verantwortung tragen wir in Schule und Industrie im Umgang mit Tieren?
Das Projekt verbindet auf anschauliche Weise verschiedene Fächer – von Chemie und Biologie über Geschichte bis hin zu Ethik. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet es nicht nur theoretisches Lernen, sondern auch unmittelbare Beobachtung und Diskussion. Eine Schülerin aus Jahrgang 12 wird ihre Erfahrungen nun als Lernprojekt weiter aufbereiten und damit einem größeren Kreis in der Schulgemeinschaft zugänglich machen.